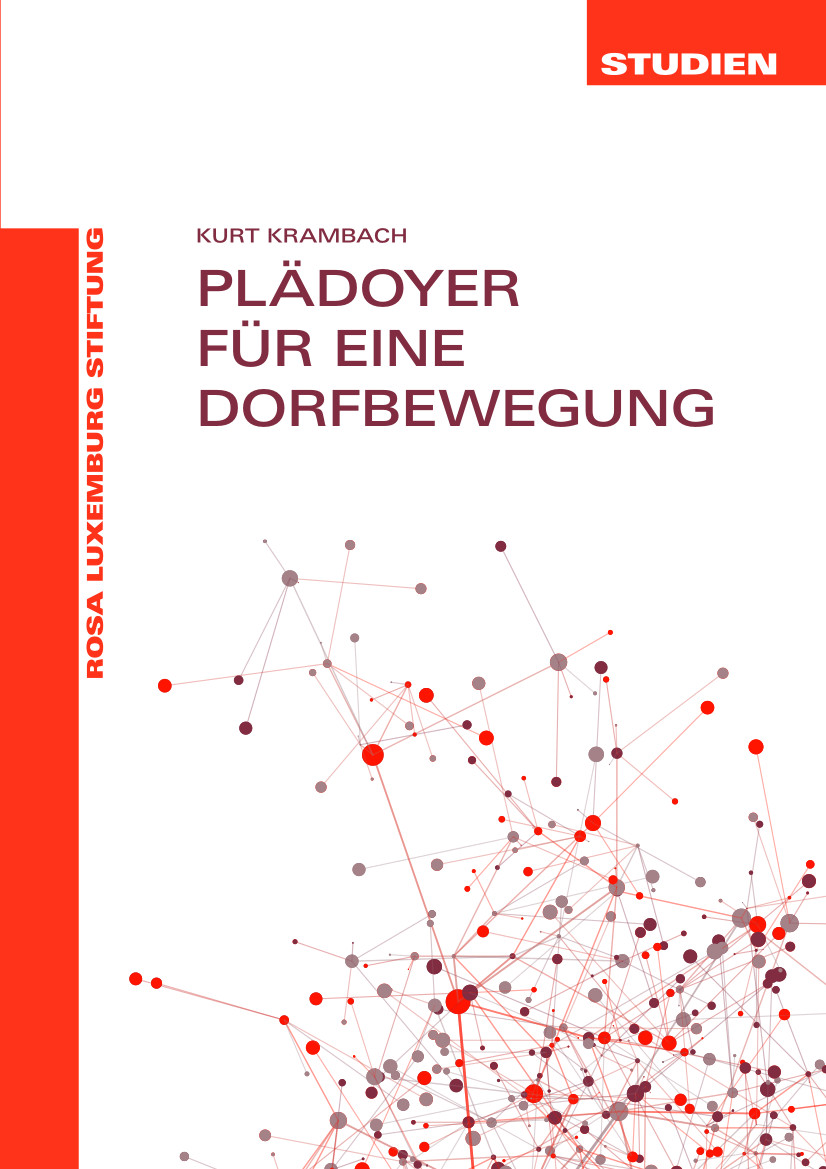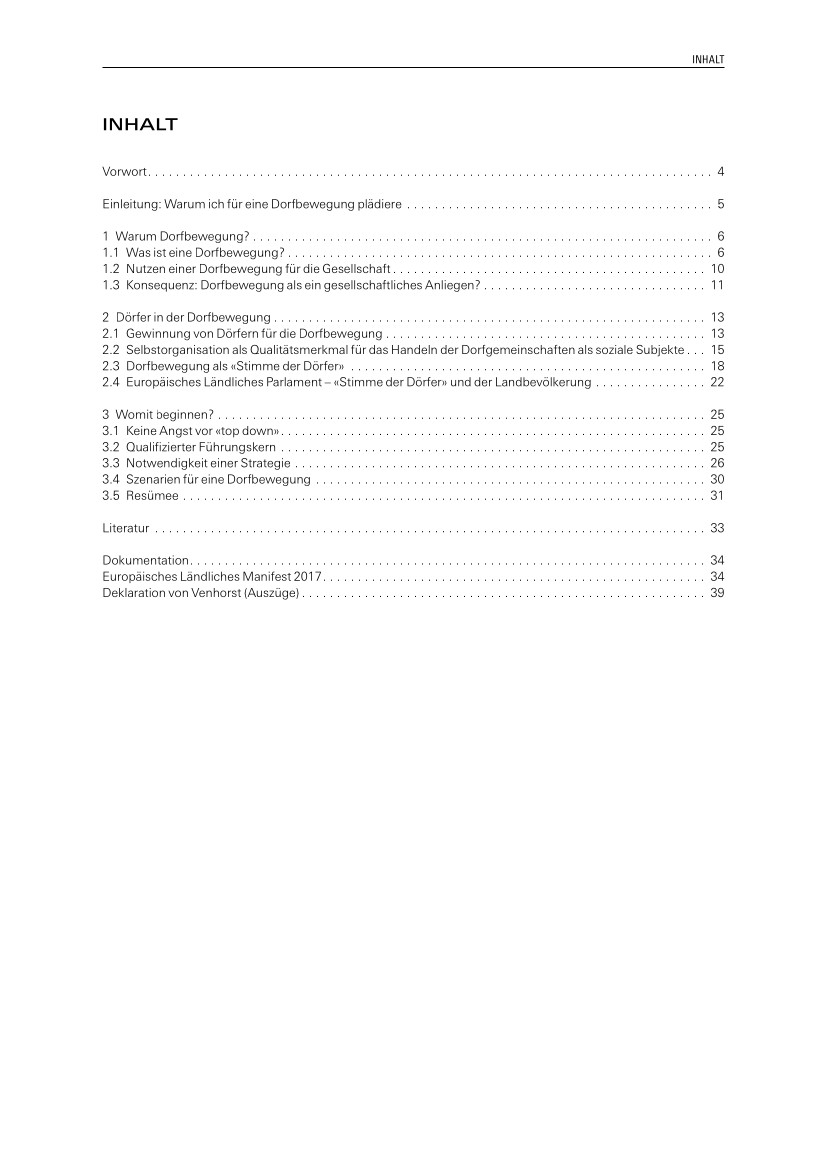7) Zusammenfassung: Wie entsteht eine Dorfbewegung?
oder: Wie schafft man eine Dorfbewegung?
Kann eine Dorfbewegung spontan entstehen oder muss sie bewusst geschaffen werden? Beides ist denkbar und fÞr beides gibt es Beispiele und Erfahrungen. Von den ersten Dorfbewegungen in Finnland und Schweden ist bekannt, dass es im Grunde mit der Entstehung der ersten Dorfaktionsgruppen begann, in denen das BedÞrfnis wuchs, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich zusammenzuschlieÃen, um stÃĪrker und lauter fÞr ihre Interessen eintreten zu kÃķnnen. Also gewissermaÃen ein Bottom up â Start? Ja, aber in beiden LÃĪndern entstanden auch zentrale Initiativen, die diesen Prozess des Zusammenschlusses der DÃķrfer zu einer landesweiten Bewegung organisierten. In Finnland erlebte ich Anfang der 1980er Jahre hautnah, wie junge Agrarsoziologen, mit denen wir im wissenschaftlichen Austausch standen, als Mitarbeiter einer UniversitÃĪt, die zu einem breiten BÞndnis von Institutionen zur Schaffung einer Dorfbewegung gehÃķrte, zu diesem Zweck LandeinsÃĪtze machten. In Schweden waren es Vertreter von kooperierenden Institutionen, die als dortige TrÃĪger einer europaweiten Kampagne der EU fÞr den lÃĪndlichen Raum die Entstehung der Dorfbewegung vorantrieben. Generell gilt wohl, dass der Entstehungsprozess einer Dorfbewegung, der doch zunÃĪchst durch den Zusammenschluss von immer mehr DÃķrfern gekennzeichnet ist, ein Gemisch von Bottom up â und Top down â Prozessen ist. In Brandenburg hatten wir die Erfahrung gemacht, dass u.a. auf Grund negativer Erfahrungen aus den Transformationsprozessen nach dem âBeitrittâ der DDR zur Bundesrepublik allgemeine Aufrufe und VerÃķffentlichungen nicht ausreichten, sondern in der Regel eine intensive ErklÃĪrungs- und Ãberzeugungsarbeit mit den Vertretern der jeweiligen Dorfgemeinschaften notwendig.
Insofern erscheint es gerechtfertigt, angesichts der vorliegenden und zugÃĪnglichen internationalen Erfahrungen folgende erste LEHRE an den Anfang zu stellen:
Der erste Schritt, um eine Dorfbewegung zu schaffen, ist die Einrichtung einer Institution, deren Personal in der Lage ist und dafÞr brennt, den Prozess der Formierung der Dorfbewegung zu planen und zu organisieren.
Dabei ist es gÞnstig, diese Initiative in eine Rechtsform zu kleiden.
Alle Erfahrungen sprechen dafÞr, dass diese Institution zivilgesellschaftlichen Charakter tragen, aber staatlich gefÃķrdert sein sollte. Die ersten Institutionen hatten lange darum kÃĪmpfen mÞssen. Inzwischen gehÃķrt es zur NormalitÃĪt, umso mehr, als das EUROPÃISCH LÃNDLCHE PARLAMENT darauf orientiert hat, dass staatliche Vertreter und Dorf- bzw. Dorfbewegungsakteure sich âauf AugenhÃķheâ begegnen mÃķgen. Egal, ob die zivilgesellschaftliche Form eine Arbeitsgruppe oder ein Office ist oder die Rechtsform eines Vereins hat, die Aufgabe, eine Dorfbewegung zu schaffen, ist etwas, das auÃerhalb dieser Institution liegt; die Bewegung ist nicht Teil dieser Institution. Egal, ob das Personal verschiedene beruflicher Herkunft oder wissenschaftlich graduiert ist oder erfahrene Dorfakteure dazu gehÃķren, sie mÞssen dafÞr qualifiziert und lernfÃĪhig sein, sollten strategisch denken und praktisch handeln kÃķnnen.
GÞnstig ist, wenn diese FÞhrungsinstitution von Anfang an mit einer GeschÃĪftsstelle und einem Kern von bezahlten Akteuren / FÞhrungskrÃĪften ausgestattet werden kann. HierfÞr wÃĪre staatliche FÃķrderung angebracht.
Zu einem spÃĪteren Zeitpunkt, nachdem die Dorfbewegung eine gewisse zahlenmÃĪÃige StÃĪrke und rÃĪumliche Ausbreitung erlangt hat, ist es sinnvoll, mittels demokratischer Wahlen einen Vorstand oder einen Rat als FÞhrungsorgan aus den Reihen der Mitglieder (ReprÃĪsentanten der Dorfgemeinschaften) zu wÃĪhlen. Damit verliert die ursprÞnglich organisierende Institution ihre FÞhrungsrolle und kann z.B. als Management, das dem Vorstand untersteht, weiterarbeiten.
Eine zweite Lehre ist, dass man von Anfang an, spÃĪtestens mit der GrÞndung der organisierenden Institution, sich in allen Entwicklungsstufen an den internationalen Erfahrungen orientieren und sie entsprechend den eigenen Bedingungen anwenden sollte.
Das betrifft sowohl die strategischen als auch die Organisationsfragen. Es ist zweckmÃĪÃig, die entsprechende Literatur zu Rate zu ziehen und die vielfÃĪltigen MÃķglichkeiten des internationalen Erfahrungsaustauschs zu nutzen. Dazu gehÃķren die MÃķglichkeiten des Kontaktes mit erfahrenen Dorfbewegungen und der Teilnahme an deren lÃĪndlichen Parlamenten wie auch die zu empfehlende Mitarbeit von Anfang an in der EuropÃĪischen Allianz der Dorfbewegungen / EUROPEAN RURAL COMMUNITY ALLIANCE (ERCA) sowie an dem zweijÃĪhrlichen EuropÃĪischen LÃĪndlichen Parlamenten / EUROPEAN RURAL PARLIAMENT (ERP). Es hat sich bewÃĪhrt, mÃķglichst viele Dorfgemeinschaften in die internationale Kooperation einzubeziehen, in Projekte und Befragungen. Wenn Dorfgemeinschaften sich mit ihren Meinungen und VorschlÃĪgen einbringen und sich dann in BeschlÞssen von ERCA oder den Verlautbaren eines ERP (der âeuropÃĪischen Stimme der DÃķrferâ) wieder finden, kann das zur StÃĪrkung des Bewusstseins der eigenen und gemeinsamen Kraft und zur Gewinnung weiterer Dorfgemeinschaften fÞr die jeweilige Dorfbewegung beitragen.
Die dritte Lehre ist, am Beginn eine Strategie auszuarbeiten, die einerseits eine Orientierung fÞr das Herangehen der organisierenden Institution an die Entwicklung der Dorfbewegung und andererseits die strategische Grundorientierung fÞr die Rolle, die Funktion und Struktur der zu entwickelnden Dorfbewegung enthÃĪlt.
Es ist erforderlich, eindeutig zwischen der Rolle der organisierenden Institution und der von ihr zu entwickelnden Dorfbewegung zu unterscheiden. Das Team der Institution braucht eine corporate identity, die Regeln fÞr das gemeinsame und arbeitsteilige Handeln zur Entwicklung der Dorfbewegung enthÃĪlt. Vorausschauend sollten die besonderen Bedingungen fixiert werden, die zu berÞcksichtigen sind, um die Hauptaufgaben der Dorfbewegung und ihre Strukturen zu realisieren sind. Es muss klar beantwortet werden, dass die Dorfbewegung sich aus Dorfgemeinschaften formiert, die nicht Mitglied der organisierenden Institution werden sollen.
Strategisch muss auch das VerhÃĪltnis zum Staat bzw. staatlichen Institutionen geklÃĪrt werden. In manchen LÃĪndern hat sich als gÞnstig erwiesen, dass die organisierende Institution bzw. die Dorfbewegung durch Leader-Strukturen unterstÞtzt wurden. Es gab auch Beispiele, dass hauptamtliche LAEDER-Manager zugleich ehrenamtliche Funktionen in der Dorfbewegung ausÞbten. Nicht bewÃĪhrt haben sich jedoch Versuche, dass LEADER-Strukturen solche von Dorfbewegungen zu ersetzten suchten bzw. Funktionen von Dorfbewegungen ausÞben wollten. Manche mussten erst noch lernen, mit zivilgesellschaftlichen Strukturen oder KrÃĪften auf AugenhÃķhe zu kooperieren, ohne sich kontrollierend einzumischen. Anstelle der finanziellen und inhaltlichen UnterstÞtzung gab es Beispiele, dass LEADER-Strukturen zu Mitveranstaltern von lÃĪndlichen Parlamenten wurden. Damit wird jedoch das AugenhÃķhe-Prinzip verletzt und entspricht nicht den in der europÃĪischen Dorfbewegung vorherrschenden Auffassungen von der SelbststÃĪndigkeit und Eigenverantwortung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Ãhnlichen KlÃĪrungsbedarf gibt es auch zwischen den kommunalen Strukturen auf der Ebene von sogenannten âOrtsteilenâ grÃķÃerer Gemeinden, die eigentlich Gemeindeteile sind, ohne Anteil an der Selbstbestimmungsrolle der Gemeinde zu haben, und den zivilgesellschaftlichen Strukturen der Dorfbewegung auf der Dorf- (Ortsteil-) Ebene, z-B einem Dorfverein, der die Mitgliedschaft einer Dorfgemeinschaft in der Dorfbewegung reprÃĪsentiert und dessen lokale Selbstorganisation nicht durch kommunale Regelungen eingeschrÃĪnkt werden kann (siehe hierzu weiter unten: fÞnfte Lehre). Die vorausschauende Strategie sollte auch entsprechend den Besonderheiten des jeweiligen Landes die generellen Hauptaufgaben jeder Dorfbewegung â die FÃķrderung der Selbstorganisation und die Interessenvertretung der DÃķrfer â prÃĪzisieren. Hinsichtlich der Selbstorganisation betrifft das neben den schon betrachteten Elementen âSelbstbestimmungâ und âOrganisationsformen der Akteureâ die inhaltlichen Schwerpunkte der âSelbstgestaltungâ, also der fÞr viele DÃķrfer zutreffenden Aufgaben fÞr bÞrgerschaftliches Engagement aus dem allgemeinen Stand der Daseinsvorsorge sowie des demografischen und Klimawandels. Hinsichtlich der Interessenvertretung betrifft das u.a. Aufgaben, die sich aus dem Stand der staatlichen Anerkennung der Subjektrolle der Dorfgemeinschaften, den Problemen der staatlichen FÃķrderung der Dorfentwicklung und der Anerkennung der Dorfbewegung durch die staatlichen und kommunalen Organe sowie durch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, generell aus dem erreichten Niveau der âBegegnungen auf AugenhÃķheâ ergeben.
Die vierte Lehre ist, dass am Beginn die quantitative StÃĪrkung der Dorfbewegung zunÃĪchst die vorrangigste Aufgabe ist.
Dabei ist die Erfahrung wichtig, dass viele Vertreter von Dorfgemeinschaften den Schritt zur Teilnahme an einer Dorfbewegung sehr ernsthaft erwÃĪgen und sich oft erst nach geduldig erklÃĪrten oder sichtbar gewordenen Vorteilen fÞr das Dorf und die Gesellschaft fÞr eine solche Entscheidung eintreten. Jede Dorfbewegung bzw. die organisierende Institution mÞssen klÃĪren, in welcher Form die Mitwirkung bzw. Mitgliedschaft in einer Dorfbewegung auf Grund der vorhandenen kommunalen oder zivilgesellschaftlichen Strukturen sinnvoll ist. Generell sollte man das allgemein verbreitere Argument gegen die Dorfbewegung: âWir brauchen keine neuen Strukturenâ und deren BegrÞndung, dass die vorhandenen oder ergÃĪnzten kommunalen Strukturen, wie z.B. OrtsbeirÃĪte und Ortsvorsteher auf der Dorfebene, ausreichten, mit der Argumentation entkrÃĪften, dass â wie in anderem Zusammenhang schon erklÃĪrt - zivilgesellschaftliche Strukturen fÞr alle Dorfbewohner offen sind und keinerlei staatlichen Begrenzungen unterliegen. Zum Beispiel haben wir als Brandenburger Dorfbewegung, als eine Enquetekommission des Landtages die MÃķglichkeiten der StÃĪrkung der lokalen Demokratie diskutierte, um die durch die Bildung von GroÃgemeinden verursachte EinschrÃĪnkung der lokalen Selbstbestimmung auf der Dorfebene zu Þberwinden, einerseits deren VorschlÃĪge fÞr die ErmÃĪchtigung der OrtsbeirÃĪte unterstÞtzt, die vorsahen, ihnen einen Teil der kommunalen Entscheidungsbefugnisse zu Þbertragen und durch einen Teil der kommunalen Haushaltsmittel zu untermauern, aber andererseits deutlich gemacht, welche zivilgesellschaftlichen MÃķglichkeiten die lokale Demokratie auf der Dorfebene ausweiten uns vertiefen kÃķnnen, wie z.B. ZukunftswerkstÃĪtten, Aufgreifen frÞherer DorfgestaltungsplÃĪne, das bÞrgerschaftliche Engagement fÞr Projekte zur Bereicherung der Daseinsvorsorge und nicht zuletzt die Wiederbelebung der traditionellen Dorfversammlung durch verbindliche Beschlussfassungen zur LÃķsung lokaler Probleme. In Schweden und Finnland waren es sogenannte Dorf-Aktionsgruppen, die nach der Bildung von GroÃgemeinden zu einer Form wurden, in der die Dorfbewohner die Geschicke ihres Dorfes in die eigenen HÃĪnde nahmen. Diese Aktionsgruppen waren ursprÞnglich auch die hauptsÃĪchliche Form, mittels derer Dorfgemeinschaften Mitglied der Dorfbewegung wurden. In Brandenburg, wo Unterschied zu Schweden und Finnland mit der Bildung von GroÃgemeinden auf der Dorfebene neue kommunale Strukturen wie OrtsbeirÃĪte und Ortsvorsteher entstanden, wurde zunÃĪchst ein Provisorium gefunden, wie die Dorfgemeinschaft mittels einer zivilgesellschaftlichen Form in der Dorfbewegung vertreten werden konnte: Beitritt zur Dorfbewegung mittels einer schriftlicher ErklÃĪrung und Benennung einer Person des Vertrauens als Ansprechpartner, die nicht Ortsvorsteher ist oder Zusammen mit dem Ortsvorsteher diese Funktion ausÞben kann. In Schweden und Finnland sowie in den meisten LÃĪndern, in denen eine Dorfbewegung nach dem Modell dieser beiden LÃĪnder entstanden ist, haben sich die meisten Dorf-Aktionsgruppen in eingetragene Vereine umgewandelt, und diese Dorfvereine reprÃĪsentieren die jeweiligen Dorfgemeinschaften in der Dorfbewegung, Es ist zweifellos zu empfehlen, diese Erfahrung auch in Brandenburg und anderen Regionen bzw. LÃĪndern anzuwenden, sodass der Dorfverein die Grundform wird, mittels der eine Dorfgemeinschaft zur Dorfbewegung gehÃķrt.
Die fÞnfte Lehre aus den internationalen Erfahrungen ist, frÞhzeitig regionale DÃķrfernetze als weiteres Strukturelement der Dorfbewegung zu bilden.
Regionale DÃķrfernetze sollten flÃĪchendeckend angestrebt werden als eine Þberschaubare Form, in der Dorfgemeinschaften in Erfahrungsaustausch treten kÃķnnen und die Hauptaufgabe der Dorfbewegung â die FÃķrderung der Selbstorganisation der Dorfgemeinschaften â systematisch organisiert werden kann. Sie sollten jedoch nicht die einheitliche Dorfbewegung ersetzen oder zersplittern, weil das deren politischen Einfluss schwÃĪchen wÞrde,aber sie kÃķnnen auch der zweiten Hauptaufgabe jeder Dorfbewegung â Stimme der DÃķrfer zu sein und deren Interessen zu vertreten - dienen. Nach den Erfahrungen der Brandenburger Dorfbewegung wÃĪre es denkbar, einen âTag der DÃķrferâ zum Instrument der regionalen DÃķrfernetze zu machen. So kÃķnnte alle zwei Jahre ein landesweites Parlament der DÃķrfer, getragen von der Brandenburger Dorfbewegung, und alle zwei Jahre ein dezentraler regionaler Tag der DÃķrfer, getragen von den regionalen DÃķrfernetzen, stattfinden. Somit wÞrde jede Dorfgemeinschaft im jÃĪhrlichen Wechsel ein Brandenburger Parlament der DÃķrfer und einen regionalen Tag der DÃķrfer erleben und mitgestalten kÃķnnen.
Die sechste Lehre ist, dass eine Dorfbewegung nicht von HÃķhepunkten, sondern in erster Linie von der bestÃĪndigen Selbstorganisation der Dorfgemeinschaften und ihrem Erfahrungsaustausch lebt.
Jedes Dorf ist so lebendig, wie seine Dorfgemeinschaft aktiv ist. Und jede Dorfbewegung ist so stark, wie ihre DÃķrfer lebendig sind. Vanessa Halhead hat in ihrer historisch bedeutsamen Studie von 2004 Þber die Dorfbewegungen in Europa auf den Punkt gebracht, wie Dorfbewegungen entstanden sind und was ihren Kern ausmacht: Dorfbewohner haben lokale Aktionsgruppen gebildet und mit ihnen die Geschicke ihres Dorfes in die eigenen HÃĪnde genommen. Ich habe fÞr das, was Vanessa als den Kern bestimmt hat, den Begriff Selbstorganisation eingefÞhrt, der durch seine drei Bestandteile Selbstbestimmung, Selbstgestaltung und Organisation der lokalen KrÃĪfte handhabbar fÞr soziologische Untersuchungen schien. Durch Untersuchungen in vielen Brandenburger DÃķrfern konnte ein Katalog von erfolgreichen Dorfprojekten bzw. Themen zusammengestellt werden, die selbstorganisiert waren und daher als machbar auch fÞr andere DÃķrfer schienen. Siehe: Kurt Krambach, Dorfbewegung â warum und wie? Berlin 2013, S. 46 ff. Regionale DÃķrfernetze kÃķnnen aus diesen Auflistungen Themen ableiten fÞr Erfahrungsaustausche, die fÞr mehrere DÃķrfer relevant sind, oder kÃķnnen durch eigene Untersuchungen diese Themenliste weiter prÃĪzisieren. Es empfiehlt sich fÞr DÃķrfernetze, unter zwei Gesichtspunkten die Arbeit mit den Dorfgemeinschaften zu thematisieren:
Erstens durch eine Bestimmung (Analyse) der vordringlichen Probleme der meisten ihrer DÃķrfer;
zweitens durch solche Themen aus dem Bereich Selbstorganisation, die fÞr mehrere DÃķrfer relevant sind.
Danach bestehen zwei MÃķglichkeiten, den thematischen Erfahrungsaustausch mit Dorfgemeinschaften zu gestalten:
a) mit Hilfe der Vertreter von DÃķrfern, die positive Erfahrungen oder Erkenntnisse zu diesem Thema haben; b) mit Hilfe von vermittelbaren Experten.
Manche Dorfbewegungen (z.B. in Estland) haben gute Erfahrungen mit der Einrichtung eines Kompetenzzentrums gemacht, das Schulungen fÞr Dorfakteure veranstaltet oder Referenten/Moderatoren zur VerfÞgung stellen kann.
In jedem Fall geht es darum, dass seitens der Dorfgemeinschaften ein Interesse an den Themen besteht bzw. geweckt werden kann. Vorrang sollten Themen/Probleme haben, die von DÃķrfern kommen und fÞr mehrere von Wichtigkeit sind.
Die siebente Lehre besteht darin, dass HÃķhepunkte zum festen Bestandteil der Dorfbewegung gehÃķren.
Das bedeutet einerseits, dass zwischen der Bewegung und dem HÃķhepunkt ein Zusammenhang dergestalt bestehen sollte, dass der HÃķhepunkt von der Bewegung vorbereitet wird, von ihr getragen wird und dass vom dem HÃķhepunkt Impulse fÞr die Bewegung ausgehen sollten. Andererseits bedeutet es, dass der HÃķhepunkt etwas Besonderes, gegenÞber der alltÃĪglichen Bewegung Abgehobenes sein soll.
FÞr ein LÃĪndliches Parlament oder Parlament der DÃķrfer (zur Wahl der zweiten Variante des Namens siehe Abschnitt 2 — Was ist ein "LÃĪndliches Parlament"? ) bedeutet das einerseits, dass das Parlament der DÃķrfer von einem Fachgremium konzipiert (Programm des PdD) und die Vorbereitung koordiniert werden muss, wobei mÃķglichst viele Dorfgemeinschaften arbeitsteilig entsprechend dem Programm in die inhaltliche Vorbereitung einbezogen werden sollten. Das ist, vor allem durch die Vorbereitung der PrÃĪsentation von good practice â Beispielen in VortrÃĪgen, Erfahrungsaustauschen oder Ausstellungen, aber auch durch die Teilnahme an Befragungen oder soziologischen Untersuchungen mÃķglich. Dazu kann auch die Gewinnung weiterer Dorfgemeinschaften fÞr die Dorfbewegung gehÃķren. Aus dem Kreis der in diese Vorbereitungen Einbezogenen ergibt sich auch die Auswahl der Mitgestalter. Welche Impulse von dem Parlament der DÃķrfer ausgehen, hÃĪngt davon ab, wie es als besonderer HÃķhepunkt gestaltet wird. Das wird einerseits durch die AktualitÃĪt und QualitÃĪt der PrÃĪsentationen und die Ãbertragbarkeit der vermittelten Erfahrungen erreicht, andererseits aber durch eine Vielfalt und KomplexitÃĪt des Programms, die es zu einem bleibenden Erlebnis machen. DafÞr spielt der Zeitfaktor eine maÃgebliche Rolle.
Am Ende des Abschnitts 6 wurde bereits im Zusammenhang mit dem fÞr einen Tag geplanten ersten Brandenburger Parlament der DÃķrfer darauf verwiesen, warum die internationale Erfahrung, solchen Parlamenten ein mehrtÃĪgiges Programm zu geben, so wichtig fÞr den Erfolg ist. Das wesentlich Neue â die Begegnung von Dorfakteuren und Politikern auf AugenhÃķhe â bei dem so wichtige Faktoren wie Vertrauen, Offenheit und VerstÃĪndnis fÞreinander und die Probleme des Anderen, gemeinsames Suchen nach der LÃķsung von Problemen in der Praxis der lÃĪndlichen Entwicklung â all das geschieht eben nicht in traditionellen Fachkonferenzen, sondern in lÃĪngeren gemeinsamen Erlebnissen, sei es in Seminaren oder Exkursionen, in den dafÞr geplanten Pausen und mehreren Abendveranstaltungen mit Geselligkeit und kulturellen Erlebnissen, aber dafÞr braucht es Zeit und sind kostbare 3 oder 4 Tage ein niedriger Preis. Und daraus erwachsenen fÞr die verschiedenen Teilnehmer gemeinsame und verschiedene Impulse, die sie fÞr ihr weiteres Schaffen mit nach Hause nehmen kÃķnnen. Und â wie an anderer Stelle schon einmal gezeigt: Die Rolle eines solchen Ereignisses als persÃķnliches und gemeinsames Erlebnis stÃĪrkt auf einmalige Weise das Selbstbewusstsein der Dorfakteure und den Stolz darauf, Dorfbewohner zu sein.
Die achte Lehre besteht darin, dass die staatliche Anerkennung und finanzielle FÃķrderung der Dorfbewegung unverzichtbar fÞr deren Erfolg und die Entwicklung lebendiger und zukunftsfÃĪhiger DÃķrfer ist.
Diese grundlegende internationale Erfahrung soll abschlieÃend noch einmal hervorgehoben werden. Diese Erfahrung besagt, dass jede Dorfbewegung Þberwiegend durch ein hohes Maà freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit zustande kommt, jedoch das entsprechend hohe Maà an Leitungs- und Organisationsarbeit allein durch ehrenamtliche KrÃĪfte nicht ausreicht und daher finanzielle FÃķrderung eines hauptberuflichen Managements erfordert.
Dem steht ein unermesslich hoher gesellschaftlicher Nutzen gegenÞber, der durch die Dorfbewegungen bewirkt wird.
Wie der Chefmanager der schwedischen Dorfbewegung in seinem Vortrag auf der internationalen Dorfkonferenz 2011 in Berlin berichtete (siehe: READER S.18ff.), unterstÞtzte die schwedische Regierung die Dorfbewegung von Anfang an finanziell, so im Jahr 2010 mit der bis dahin hÃķchsten Summe von 1.6 Millionen EURO; demgegenÞber wÞrden die 5000 Dorfaktionsgruppen, aus denen diese Bewegung besteht, jÃĪhrlich durch freiwillige Arbeit und Geldaufwendungen ca. 150 Millionen EURO fÞr die Entwicklung ihrer DÃķrfer aufbringen. Also auch Ãķkonomisch rentiert sich die finanzielle UnterstÞtzung der Dorfbewegung durch den Staat um ein Vielfaches.
Dorfbewegungen, ihre zivilgesellschaftlichen Strukturen in den DÃķrfern und ihre europÃĪische Allianz sind zu anerkannten zivilgesellschaftlichen Partnern der Politik auf allen staatlichen Ebenen und der kommunalen Ebene geworden.
Nationale LÃĪndliche Parlamente und das europÃĪische Parlament haben bewirkt, dass sie zu einer neuen Form der Begegnung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und politischen EntscheidungstrÃĪgern geworden.
Die europÃĪische Allianz der Dorfbewegungen und das EuropÃĪische LÃĪndliche Parlament wurden von der EU und dem Europarat anerkannt und gefÃķrdert. Vertreter der Allianz der Dorfbewegungen wurden in mehrere Fachgremien der EU berufen.
Dorfbewegungen haben national und international Wirkungen auf die nachhaltige Entwicklung, Lebendigkeit und LebensfÃĪhigkeit der DÃķrfer als dauerhafte menschliche Existenzformen.
Dorfbewegungen haben nachweislich die lokale Demokratie auf der Dorf- und Kommunalebene gestÃĪrkt und bereichert.
Jede Dorfbewegung braucht eine staatliche finanzielle FÃķrderung ihrer primÃĪren Hauptaufgabe, die Selbstorganisation der Dorfgemeinschaften zu fÃķrdern, die finanzielle FÃķrderung von DÃķrfernetzen des Erfahrungsaustauschs und die finanzielle FÃķrderung von zivilgesellschaftlichen Parlamenten der DÃķrfer. Es reicht nicht aus, die eine oder andere Seite zu fÃķrdern, sondern dieses ganze Paket braucht finanzielle UnterstÞtzung.
Mit der FÃķrderung darf keine AbhÃĪngigkeit, Kontrolle oder Einflussnahme entstehen. Erfahrung von Dorfbewegungen: Vermeidung der gemeinsamen staatlichen und zivilgesellschaftlichen TrÃĪgerschaft von Veranstaltungen der Dorfbewegung statt deren FÃķrderung, um die EigenstÃĪndigkeit und den zivilgesellschaftlichen Charakter der Dorfbewegung nicht zu beeintrÃĪchtigen.
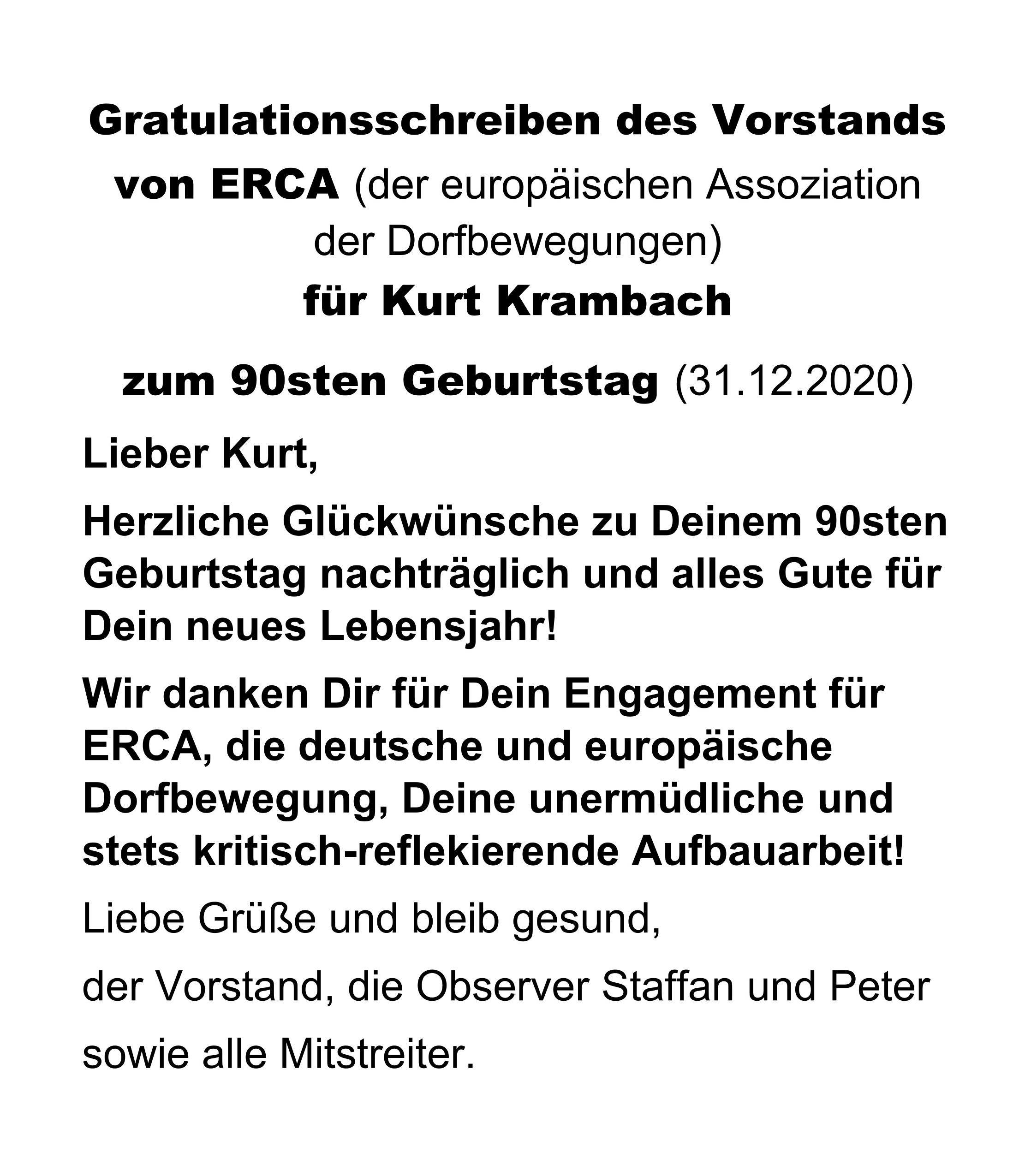
|
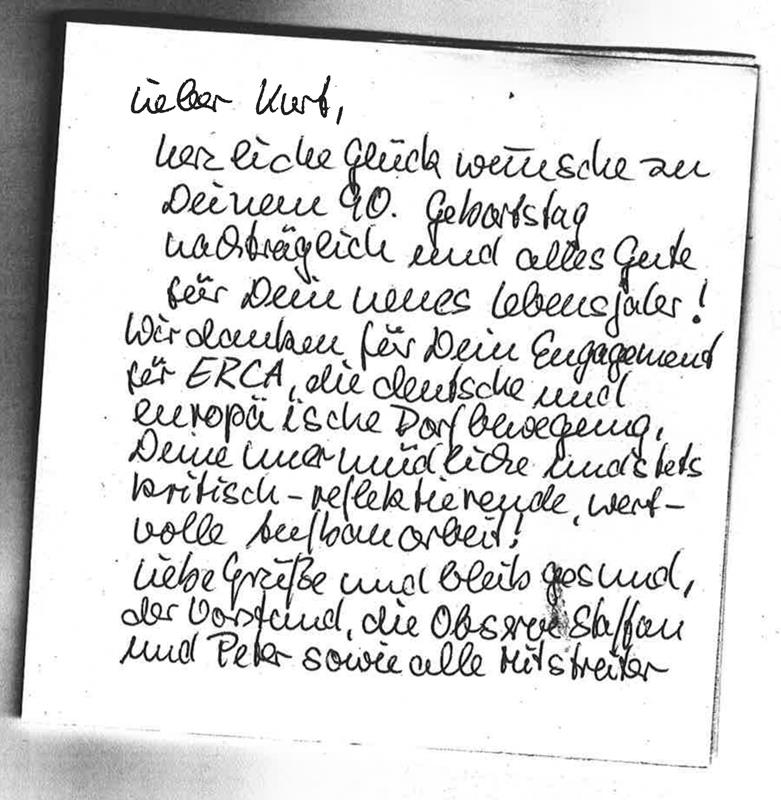
|
| Peter Backa und Staffan Bond gehÃķren als MitbegrÞnder der finnischen buw. schwedischen Dorfbewegung zu den Veteranen der europÃĪischen Dorfbewegung und unterstÞzten deren Etablierung in Deutschland; sie waren wie Kurt Krambach mehrere Wahlperioden Vorstansmitglieder von ERCA und wurden alle drei 2016 als "observer" berufen, um weiter im Vorstand beratend mitarbeiten zu kÃķnnen. | |
|---|---|
Literatur:
- Kurt Krambach, PlÃĪdoyer fÞr eine Dorfbewegung
- 10 Argumente fÞr eine (gesamt-)deutsche Dorfbewegung
- Kurt Krambach, Dorfbewegung â warum und wie. Berlin 2013
- READER Dorfkonferenz 2011
- Vanessa Halhead, Dorfbewegungen in Europa
- V.Halhead, 10 Barrieren, die von den Dorfbewegungen Þberwunden werden mussten
- Stig Hannson Erfahrungen der schwedischen Dorfbewegung
Adressen
Dorfbewegung Brandenburg e.V.
www.lebendige-doerfer.de
info@lebendige-doerfer.de
European Rural Community Alliance (ERCA) EuropÃĪische Allianz der Dorfbewegungen
www.ruralcommunities.eu
Vanessa Halhead (ERCA-Coordinator) vanessa@duthchas.org.uk
European rural Parliament (ERP) Europ. LÃĪndliches Parlament
www.europeanruralparliament.com
Schwedische Dorfbewegung
www.helasverige.se
info@helasverige.se